Pro & Contra: Brauchen wir einen neuen Begriff für digitale Kompetenzen?
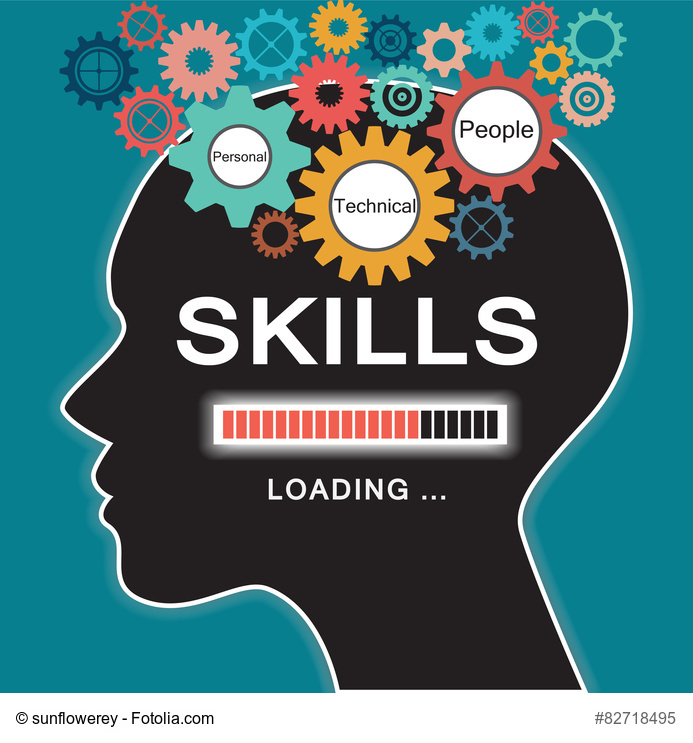
Auf der Konferenz „Digitale Kompetenzen“ am 17. Mai haben wir bei Twitter gefragt: Ist der Begriff zu technologieorientiert, brauchen wir einen neuen Namen? Eine Teilnehmerin war dafür, Jasmin Zouizi dagegen. Beide haben ihre Haltung für den Online-Dialog noch einmal begründet.
Pro: Flipped ModelSkills – ein Begriff mit Tradition für digitale Kompetenzen?
Von digitalen Kompetenzen zu sprechen, lenkt den Blick auf die digitale Technik. Das wurde auf der Konferenz „Gute digitale Arbeit in europäischen Metropolen gestalten. Digitale Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung von morgen“ am 17. Mai in Berlin immer wieder kritisiert. Zu Recht.
Was wäre, wenn wir stattdessen von Flipped ModelSkills sprechen würden? Dann wäre unser Blick auf die ModelSkills gelenkt, womit hier die menschliche Fähigkeit zur Modellbildung gemeint ist. Bei einem Modell wird die Wirklichkeit abgebildet auf der Grundlage der Prinzipien Abbildung, Verkürzung, Pragmatismus. Flipped spiegelt wider, dass digitale Technik nur ein historisches Phänomen in der Geschichte der Modellbildung ist.
Modellbildung hat eine lange Tradition in der Menschheitsgeschichte – in Mathematik, Architektur, Kunst, Ingenieur-, Wirtschafts-, Natur-, Literatur-, Sozialwissenschaften, Psychologie … Und Modellbildung ist die Grundlage der Arbeit in der Informatik. Wenn für ein Problem eine Lösung mit Hilfe eines Informationssystems gefunden werden soll, muss zuerst ein Modell der Wirklichkeit entworfen werden. Diverse Modellierungssprachen wurden entwickelt, um die unterschiedlichen Ebenen eines Informationssystems zu beschreiben, wie etwa Prozesse, Daten, Softwarefunktionen, IT-Architektur, Laufzeitverhalten etc. Letztendlich ist ein digitales System aber im Ergebnis immer mehr als die Summe dieser Modellierungssprachen, es basiert auf einem Metakonzept eines Modells, das von älteren Wissenschaften oder schönen Künsten entwickelt wurde.
Reduziert ModelSkills digitale Kompetenzen nicht wieder auf technische Engineering-Kompetenzen? Nein. Modellbildung ist ja keine Erfindung der Ingenieurwissenschaften, sondern auch die Grundlage der Human- und Sozialwissenschaften. Die digitale Technik erfindet unsere menschliche Fähigkeit zur Persönlichkeitsentwicklung und Teamarbeit nicht neu. Sie schafft lediglich neue Ausdrucksformen. Auch die Notwendigkeit, Informationen zu überprüfen, ist kein Phänomen digitaler Medien. Die Angabe einer seriösen Quelle gehört zur publizistischen Sorgfaltspflicht seit Erfindung der Presse.
Gehören ModelSkills zum Mindset oder SkillSet? Zu beiden Kategorien. Die menschliche Fähigkeit zur Modellbildung ist eine Komponente des Mindsets, die Modelle der verschiedenen Wissenschaftszweige und schönen Künste gehören zum SkillSet.
Schulen sollten den Schülern so früh wie möglich einen neugierigen Blick auf die Architektur von Suchmaschinen, Systemen, Software, Hardware ermöglichen – und ihren unterschiedlichen Welt – und Menschenbildern. Der Begriff „Flipped ModellSkills“ würde das erleichtern.
Contra: Das Kind beim Namen nennen – digitale Kompetenz bezieht sich immer auch auf Technologie. Von Jasmin Zouizi, Berlin
Ich denke nicht, dass digitale Kompetenz als Begriff zu technologielastig ist und wir deshalb einen neuen Namen brauchen. Digitale Kompetenz ist ein Konzept, das Wissen und Fähigkeiten beschreibt, um mit digitalen Medien die Herausforderungen der Gesellschaft zu meistern. Und da in diesem Konzept Herausforderungen der Gesellschaft mithilfe digitaler Medien gelöst werden, müssen das notwendige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten zwangsläufig technologiebezogen sein.
Eine Mutter, die einen Onlineshop aufbaut, um von zu Hause aus Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen, zeigt digitale Kompetenz. Ein Syrer, der sich auf der Flucht mit Hilfe seines Smartphones organisiert, zeigt digitale Kompetenz. Und auch die Schulklasse, der es gelingt, den kranken Klassenkameraden per Video und Audio mit dem Unterrichtsstoff der letzten Wochen zu versorgen, zeigt digitale Kompetenz.
Drei sehr unterschiedliche Beispiele, die jedoch zeigen, wie Herausforderungen mithilfe neuer Technologien gelöst werden. In allen drei Beispielen nutzen Menschen technologiebezogenes Wissen und technologiebezogene Fähigkeiten um die entsprechende Herausforderung zu meistern. Um auf das Beispiel der Schulklasse zurückkommen: Die Schüler entscheiden nicht nur, dass sie mithilfe digitaler Medien den kranken Mitschüler unterstützen möchten, sondern auch welche digitalen Formate im Einzelfall passen. Abhängig ist das davon, wie das Unterrichtswissen am besten vom kranken Mitschüler aufgenommen werden kann. Entwickelt der Lehrer beispielsweise ein Tafelbild, ist ein Video sinnvoll. Hält er beispielsweise einen Vortrag reicht eine Audioaufnahme. Und auch die körperliche Verfassung des kranken Mitschülers müssen die Schüler berücksichtigen, wenn sie ihn bedarfsgerecht mit Unterrichtsstoff versorgen wollen.
Das Wissen und die Fähigkeiten, die hier benötigt werden, sind divers – aber immer technologiebezogen. Unter digitalen Kompetenzen verstehe ich im Einzelnen folgendes:
- Das Erkennen von Chancen, die eine digitalisierte und vernetzte Welt für die Lösung einer Herausforderung bietet.
- Das Nutzen von Technik in Form von Programmen und Webanwendungen, um der Herausforderung begegnen zu können. Dabei gehen wir unterschiedlich vor. Einige knien sich tief in die Programmierung und erstellen alles selbst. Andere versuchen nur die Zusammenhänge zu verstehen und suchen sich für alles andere Unterstützung. Hier geht es um technologiebezogene Fähigkeiten.
- Das richtige Einschätzen von Chancen und Risiken der sozialen Medien. Wir wissen über die unterschiedlichen Anforderungen von Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest und können sie anwenden.
All das setzt in hohem Maße technologiebezogenes Wissen und technologiebezogene Fähigkeiten voraus. Wer also am Begriff digitale Kompetenz die „Technologielastigkeit“ bemängelt, unterschätzt den hohen Anteil technologiebezogener Elemente, die diesen Begriff formen.
Jasmin Zouizi koordiniert festangestellt in Teilzeit europäische Arbeitsmarkt- und Bildungsprojekte. Nebenbei gründet sie eine Online-Plattform mit Existenzgründungstrainings für Mütter. Mehr...
